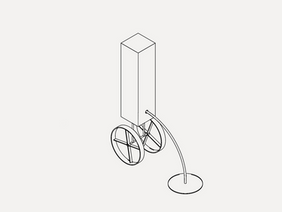Carrelli del Mercato Centrale Torino
Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Albert Camus
Etwas abseits der großen Markthalle des Mercato Centrale Torino stehen zusammengeschoben unzählige Handkarren. Täglich werden die Früchte des Piemont mithilfe dieser Karren in der Markthalle aufgetischt und, was übrig bleibt, wieder abgefahren – die Halle ist, allabendlich, danach buchstäblich wie ausgefegt. Und täglich in stetem Rhythmus füllt und leert sich diese große Halle – ein walfischgroßer Bauch, bulimisch, atmend, zwischen Leben, Überfülle und Leere.
Die Karren, eher Fahrgestelle, eiserne Gerippe – römische Streitwagen im Industriallook. Rachitisch, archaisch, zerschossen, sie werden, unisono, augenscheinlich mit kühler Gleichgültigkeit behandelt: hart gegen die Straße und hart gegen die willfährigen Geschöpfe, die sie durch die engen Gassen zerren, deren Mühsal, durch ein Nie-enden-wollen und Nie-fertig-werden gekennzeichnet ist. An den Gefährten ist nur das Allernotwendigste vorhanden und gerichtet, Bleche und Profile roh gefügt. Allein die Ware ruht sanft auf übergroßen Blattfedern, die den unbereiften Rädern selbst bei großen Lasten die Stöße nehmen.
Das Eisen nackt, aber kein Rost am Gestell und vom Schweiß der Hände die Griffrohre speckig blank. Allen Karossen gemein ist eine schlanke, überlange Form, tragjochartig, um die herum in einem engen Rahmen maßliche Abweichungen oszillieren. In diesen auch baulichen und formalen Besonderheiten drückt sich einerseits die Anpassungen der Wagen an die damit transportierten Waren aus. Und andererseits lässt das Wegenetz der großen Halle nur gewisse Dimensionierungen zu – mit Wagen ab einer bestimmten Länge kann man die Halle nur je in Längs- oder Querrichtung durchmessen, wie bei überhaupt allen Fahr- zeugen, wird bei ihnen besonders deutlich, dass eine Weg-Ort-Verbindlichkeit zwischen Fuhrwerken, dem Marktstand und den zurückzulegenden Routen besteht.
Sie stellen eine Flotte dar, die man als Spezialfahrzeuge bezeichnen kann und in dieser Kategorie könnte man sie zu einer Unterart der „Diskreten“ zählen. Dies wären Fahrzeuge, die in der Regel, in einem räumlich begrenzten Umfeld, meist repetitiver und oder hoch spezialisierter Verrichtungen nachkommen. Ihr Habitat ist nicht öffentlich, sie verrichten ihr Werk in den abgeschotteten weitläufigen Anlagen der Industrie und nur ab und an bekäme man sie, eher zufälligerweise, zu Gesicht, wenn sie für einen Spezialauftrag, als Kuriosität wahrgenommen, in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten.
Im Fall der Karren des Mercato Centrale sind diese merkwürdigen Gefährte zwar öffentlich präsent und stellen schon aufgrund ihrer Anzahl eine eigentlich nicht zu übersehende imposante Schar dar. Allein das Bild der zusammengeschobenen Wagen scheint ohne Organisation zu sein. Folgt man der Idee, dass die sichtbare Anordnung der Dinge durch die Erzeugung einer Art Metastruktur (mittels Rhythmik / Figuration
/ Staffelungen, etc.), die Vorwegnahme eines Planes der möglichen Verwendung herstellen kann, so ist bei dem chaotischen Haufen der stählernen Gesellen das Gegenteil ablesbar. De facto aber wäre dieser Schluss voreilig, denn allmorgendlich, die Stadt schläft noch, löst sich das Knäuel auf wundersame Weise und wohlgeordnet wird ein Wagen nach dem anderen herausgezogen, bestückt, in die Halle gefahren, entladen und das Ganze dann vice versa abends retour.
Dies geschieht zügig, still und fließend, jede Bewegung sitzt, jeder Wagen einer geheimen Choreografie folgend, findet blind seine Position am Ende einer langen Kette, auf- und abfädelnd bereit, nach kurzer Nacht, noch bevor es dämmert, den Reigen von neuem zu eröffnen.
Ephemere – oder die Drift der Dinge
Ich halte mich an diesem verkrüppelten Baum
verlassen in diesem Trichter
der die Öde
eines Zirkus´
vor oder nach der Schaustellung hat
und ich betrachte das ruhige Vorüberziehen
der Wolken über dem Mond (…)
Giuseppe Ungaretti
Noch sind sie da, die Marktwagen in Turin, man weiß nicht wie lange noch. Hier und doch schon im Entschwinden – in ihnen steckt mehr ein Überlebtes als ein Überlebendes. Und bei genauerer Betrachtung befinden sich sogar die Mehrzahl der Dinge und Bedingungen unserer Gegenwart in einem »noch«. Es sind dies Kuriosa, zwischen Zumutung und Herausforderung, zwischen gehen und bleiben. Heterotopien, Reminiszenzen an das Gestern, Konservierungen, (Ver-)Kapselung der Zeit. Die Vergangenheit ist abgeschlossen, ihr kann nichts hinzugefügt werden. Das ist ihre Attraktivität. Wir, die Überlebenden, die wir außerdem den Bruch mit der Geschichte vollzogen haben, schreiben keinen Text mehr fort, wir erfinden ihn täglich aufs neue, wir lieben dafür das schlüssige Bild, das Diktum übernehmen Meme seit Geschichte abhandengekommen ist. Es sind abgeschlossene Bilder, die je für sich einen Kosmos der Kohärenz beschreiben, ihn zumindest versprechen, allerdings einen monadischen. Wir, die Protagonisten, stehen am Zaun, das ist der Deal: Wer das Eineindeutige preisgibt, der Auswahl wegen oder aufgrund des nicht Entscheidenkönnens oder -wollens, muß draußen bleiben. Es ist nun ein Narrativ, das die Geschichte aber nicht wett macht, sondern verfügbar ist als Ressource mythisch unverbindlichen Allerleis.
Die Rückschau als Bezug hat sich erledigt, die Vorschau, zur Tages- und Momentschau, als Forderung und Bedingung. Die Geste hat nicht von ungefähr närrische Züge: Sie dient der Unterhaltung. Allerdings bleibt zunehmend das Lachen auf der Strecke, der Gang wird unsicher, auf rohen Eiern, ständig dreht der Kopf, nach hinten und nach vorn. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und das Diktum der Zeit. Man darf gespannt sein was das für Geschichtchen sind, die sich auf sich selbst beziehen, und wie wir mit ihnen leben, so wir uns an sie gewöhnen. Womöglich sind es Rückkopplungsphänomene, die sich da zeitigen, verstümmelte Bilder, Chiffrierungen aus irgendwie und irgendwoher Bekanntem, schlecht zu entziffern, Kaffeesatzleserei – es verschwimmen die Vorbilder, das schon Gesehene, dem scharfen Blick die Kante. Warum aber gibt es sie noch, diese Wagen, was hält sie fest? Der Verzicht auf das Eingeständnis des Unzeitgemäßen und die Alternative, den Ersatz, auf ein zeitgemäßes wie angemessenes Marktkonzept, das auf entsprechende Infrastrukturmaßnahmen, durchrationalisierte Logistik und auf Robotik setzt. Der Verzicht, der eigentlich ein Beharren ist, begründet sich letztlich aus der Weigerung, womöglich auch einem Unvermögen, einen letzten Strohhalm loszulassen. Als wolle man sich noch an irgendetwas festhalten, während das Karussell auf Touren kommt und schon beginnt zu ächzen. Eine Zerreißprobe mit sicherem Ausgang.
Vom Erscheinen im Verschwinden
Die Werkgruppe „Ephemere“ bezieht sich sowohl thematisch als auch formal auf die Entdeckung (»Sichtung«) der Marktkarren der Turiner Markthalle. Es ist hier vor allem das „Unzeitige“, das heraussticht. Einerseits anachronistische mobile Vertreter des 18. und 19. Jahrhunderts, historisch technisch gesehen – was nicht heißt, dass die Herstellung der Wagen auch jüngeren Datums ist – und andererseits, aktueller integral funktionaler Bestandteil der Kybernetik des Marktes.
„Das Glatte ist die Signatur der Gegenwart. Es verbindet Skulpturen von Jeff Koons, i-Phone und Brazilian Waxing miteinander. Warum finden wir heute das Glatte schön? Über die ästhetische Wirkung hinaus spiegelt es einen allgemeinen gesellschaftlichen Imperativ wider. Es verkörpert nämlich die heutige Positivgesellschaft. Das Glatte verletzt nicht. Von ihm geht auch kein Widerstand aus.“ Das Glatte aus „Die Errettung des Schönen“ (Byung-Chul Han)
Der Begriff „Ephemere“ ist emblematisch zu verstehen. Als Signum unserer Zeit bündelt sich in ihm das für die Kultur der Gegenwart charakteristische Momentum des Vorübergehenden – zum Glatten passt das Gleiten. In den exzeptionellen Dingen unserer Zeit, konkretisieren sich, in nie da gewesener Weise – ohne Vorbild – (in diesem Sinne geschichtsvergessen) Wissen, Technizität und die Globalisierung der Kultur. Diesen Dingen eigen ist unter anderem eine physische Erscheinung von geradezu transzendenter Qualität, die sich mit tradierten Erfahrungen in Bezug auf Beschaffenheit, Herstellung und Herkunft kaum mehr erfassen lassen. In ihnen wird etwas Überzeitliches präsent, denn ihre Attraktivität resultiert aus einer Spannung eines an sich paradoxen Verhältnisses aus Distanz, von der Unkenntnis und Unerfahrenheit gegenüber dem Objekt herrührend, und gleichzeitiger Lust auf die als unwiderstehlich erfahrene Perfektion des Gegenstandes. Selbst bei Berührung wird die Distanz nicht überbrückt, im Gegenteil, der Gegenstand entgleitet im Zugriff, verharrt gewissermaßen im Unzeitlichen, in einem Zustand der dem Idealen näher ist als dem Realen: Man kann ihn zwar berühren, aber nicht erfassen und noch bevor er sich in einem Gebrauchskontext etablieren, verfestigen kann, entzieht er sich der Eignung, Erprobung bzw. der Akkulturation durch den Ersatz des Neuen. Im Erscheinen formuliert sich bereits die Götterdämmerung des Gegenstandes, er kommt um zu gehen, in ihm formuliert sich schon das Neue, das Versprechen eines noch Attraktiveren. Wir sind nicht sicher in unserer Zeit, zwar wähnen wir uns bereits in einer Distanz zur Moderne, in einer zeitlich geschichtlichen Opposition, die die Moderne als historisch und überwunden versteht.
Die Erfahrung der Beschleunigung (Überfülle der Ereignisse), der Differenzierung (Komplexitätszuwachs und -erfahrung) / (Überfülle des Raumes), der Shift der Perspektive von der Gesellschaft hin zum Subjekt (Individualisierung der Referenzen) wird einerseits selbstverständlich gelebt, andererseits aber nicht selbstbewusst und, vor allem, selbstsicher erlebt. Die Symptome sind Unsicherheit, die sich physisch als Schwindel manifestiert, das Gefühl des Verlustes an Verortung und schließlich, das Empfinden eines Unbehagens, resultierend aus der Erfahrung einer als diffus erlebten Identität.
Angesichts der Entgrenzung, des Verlustes an Fokussierung, kommt die Katastrophe, vielmehr die Bedrohung, gerade recht. Sie wird gefürchtet, wie herbeigesehnt, sie bietet Orientierung über alles andere hinweg:
Angesichts des Klimawandels und der Pandemien machen sich die Katastrophenszenarien der Zeit wie Petitessen aus. Die Katastrophe egalisiert, sie ist basisdemokratisch: vor ihr sind tatsächlich alle gleich.
„Einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag“ so beschreibt Walter Benjamin den Begriff der Aura in seinem Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“. Es ist die Aura, die die Werke zu historischen Zeugen macht und ihnen Autorität verleiht.
Mit der Reproduzierbarkeit hebt sich sowohl die Einmaligkeit auf, als auch deren Ferne, ein Kunstwerk wird zu jeder Zeit an jedem Ort darstellbar und besitzbar. Damit verliert es seine historische Zeugenschaft und letztlich seine Autorität.
Die Aura des Kunstwerks zerfällt zugunsten des Anliegens der Massen, sich mit der Aufnahme der Reproduktion die Dinge näherzubringen. Benjamin bedauert den Umstand des Verlustes nicht ausdrücklich, stellt doch die allgemeine Zugänglichkeit und Verfügbarkeit ein Gewinn dar.
Nach nunmehr nur zwei Generationen lässt sich aber feststellen, dass mit dem Verlust der Aura (auch wenn der Begriff nach wie vor hohe spekulative Spielräume lässt), des konkreten Ortes, wie des zeitlichen Rahmens eines Ereignisses oder eines Objekts, ein ebensolcher Verlust in der Rezeptions- und damit Identitätserfahrung zu verzeichnen ist.
Die exklusive Erfahrung der „Ferne“ ist einer permanenten der „Nähe“ gewichen, die sich aber konsequent als Distanz konstituiert und entsprechend als nicht erreichbar erlebt wird.
Das Auratische des modernen Gegenstandes ist demzufolge die latente Erscheinung einer Nähe, so fern sie auch sein mag. Der Rezipient erfährt sich in dieser Nähe als Außenstehender, der, als Zuschauer in einer Welt, in der er zwar konkret vorhanden, aber nicht verankert ist, als in einem Ozean des Lebens Treibender.
Einer der Grundannahmen der Arbeit ist die Erkenntnis, dass wir es versäumt haben, ein allgemeines, kritisches Bewusstsein gegenüber unserer Kultur zu entwickeln, statt dessen verharren wir in der Drift, in einer Indifferenz und damit einer Latenz gegenüber dem Leben. Dieses allerdings fordert ein Ankommen, wollen wir zu uns kommen:
Es ist an der Zeit, erwachsen zu werden.
Ephemere

Ephemere
Etwas abseits der großen Markthalle des Mercato Centrale Torino stehen zusammengescho- ben unzählige Handkarren. Täglich werden die Früchte des Piemont mithilfe dieser Karren in der Markthalle aufgetischt und, was übrig bleibt, wieder abgefahren – die Halle ist all- abendlich danach buchstäblich wie ausgefegt. Und täglich in stetem Rhythmus füllt und leert sich diese große Halle – ein walfischgroßer Bauch, bulimisch, atmend, zwischen Leben, Übervülle und Leere.
Die Karren, eher Fahrgestelle, eiserne Gerippe – römische Streitwagen im Industriallook. Rachitisch, archaisch, zerschossen, sie werden, unisono augenscheinlich mit kühler Gleichgültigkeit behandelt: hart gegen die Straße und hart gegen die willfährigen Geschöpfe die sie durch die engen Gassen zerren, deren Mühsal, durch ein Nie-enden-wollen und Nie-fertig-werden gekennzeichnet ist. An den Gefährten ist nur das Allernotwendigste vorhanden und gerichtet, Bleche und Profile roh gefügt. Allein die Ware ruht sanft auf übergroßen Plattfedern, die den unbereiften Rädern selbst bei großen Lasten die Stöße nehmen. Das Eisen nackt aber kein Rost am Gestell und vom Schweiß der Hände die Griffrohre speckig blank. Allen Karossen gemein ist eine schlanke überlange Form, tragjochartig, um die herum in einem engen Rahmen maßliche Abweichungen oszillieren. In diesen auch baulichen und formalen Beson-
derheiten drückt sich einerseits die Anpassungen der Wagen an die damit transportierten Waren aus.
Und andererseits läßt das Wegenetz der großen Halle nur gewisse Dimensionierungen zu – mit Wagen ab einer bestimmten Länge kann man die Halle nur je in Längs- oder Querrichtung durchmessen, wie bei überhaupt allen Fahr- zeugen, wird bei ihnen besonders deutlich, dass eine Weg-Ort-Verbindlichkeit zwischen Fuhrwerken, dem Marktstand und den zurück- zulegenden Routen besteht.
Sie stellen eine Flotte dar die man als Spezialfahrzeuge bezeichnen kann und in dieser Kategorie könnte man sie zu einer Unterart der „Diskreten“ zählen. Dies wären Fahrzeuge die in der Regel, in einem räumlich begrenzten Umfeld, meist repetitiver und oder hochspezialisierter Verrichtungen nachkommen. Ihr Habitat ist nicht öffentlich, sie verrichten ihr Werk in den abgeschotteten weitläufigen An- lagen der Industrie und nur ab und an bekäme man sie, meist zufälligerweise, zu Gesicht, wenn sie für einen Spezialauftrag, als Kuriosität wahrgenommen, in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten.
Im Fall der Karren des Mercato Centrale sind diese merkwürdigen Gefährte zwar öffentlich präsent und stellen schon aufgrund ihrer Anzahl eine eigentlich nicht zu übersehen- de imposante Schar dar. Allein das Bild der
zusammengeschobenen Wagen scheint ohne Organisation zu sein.
Folgt man der Idee, dass die sichtbare Anordnung der Dinge durch die Erzeugung einer Art Metastruktur (mittels Rhythmik / Figuration
/ Staffelungen, etc.), die Vorwegnahme eines Planes der möglichen Verwendung herstellen kann, so ist bei dem chaotischen Haufen der stählernen Gesellen das Gegenteil ablesbar. De facto aber wäre dieser Schluss voreilig, denn allmorgendlich, die Stadt schläft noch, löst sich das Knäuel auf wundersame Weise und wohlgeordnet wird ein Wagen nach dem anderen herausgezogen, bestückt, in die Halle gefahren, entladen und das Ganze dann vice versa abends retour.
Dies geschieht zügig, still und fliessend, jede Bewegung sitzt, jeder Wagen einer geheimen Choreografie folgend findet blind seine Position am Ende einer langen Kette, auf- und abfedelnd bereit, nach kurzer Nacht noch bevor es dämmert, den Reigen von neuem zu eröffnen.
II
Noch sind sie da, die Marktwagen in Turin, man weiß nicht wie lange noch. Hier und doch schon im Entschwinden – in ihnen steckt mehr ein Überlebtes als ein Überlebendes. Und bei genauerer Betrachtung befinden sich sogar die Mehrzahl der Dinge und Bedingungen unserer Gegenwart in einem »noch«.
Es sind dies Kuriosa, zwischen Zumutung und Herausforderung, zwischen gehen und bleiben. Heterotope, Reminiszenzen an das Gestern, Konservierungen, (Ver)Kapselung der Zeit. Die Vergangenheit ist abgeschlossen, ihr kann nichts hinzugefügt werden. Das ist ihre Attraktivität. Wir, die Überlebenden, die wir ausserdem den Bruch mit der Geschichte vollzogen haben, schreiben keinen Text mehr fort, wir erfinden ihn täglich aufs neue, wir lieben dafür das schlüssige Bild, das Diktum übernehmen Meme seit Geschichte abhanden gekommen ist. Es sind abgeschlossene Bilder die je für sich einen Kosmos der Kohärenz beschreiben, ihn zumindest versprechen, allerdings einen monadischen. Wir, die Protagonisten, stehen am Zaun, das ist der Deal: wer das Einein-deutige preisgibt, der Auswahl wegen oder aufgrund des nicht Entscheidenkönnens oder -wollens, muß draußen bleiben.
Es ist nun ein Narrativ, das die Geschichte aber nicht wett macht, sondern verfügbar als Ressource mythisch unverbindlichen Allerleis. Die Rückschau als Bezug hat sich erledigt, die Vorschau, zur Tages- und Momentschau, als Forderung und Bedingung. Die Geste hat nicht von ungefähr närrische Züge: sie dient der Unterhaltung. Allerdings bleibt zunehmend das Lachen auf der Strecke, der Gang wird unsicher, auf rohen Eiern, ständig dreht der Kopf, nach hinten und nach vorn. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und das Diktum der Zeit. Man darf gespannt sein, was das für Geschichtchen sind, die sich auf sich selbst beziehen, und wie wir mit ihnen leben, so wir uns an sie gewöhnen. Womöglich sind
es Rückkopplungsphänomene, die sich da zeitigen, verstümmelte Bilder, Chiffrierungen aus irgendwie und irgendwoher Bekanntem, schlecht zu entziffern, Kaffeesatzleserei – es verschwimmen die Vorbilder, das schon Gesehene, dem scharfen Blick die Kante. Warum aber gibt es sie noch diese Wagen, was hält sie fest? Der Verzicht auf das Eingeständnis des Unzeitgemäßen und die Alternative, den Ersatz, auf ein zeitgemäßes wie angemessenes Marktkonzept, das auf entsprechende Infrastrukturmaßnahmen, durchrationalisierte Logistik und auf Robotik setzt.
Der Verzicht, der eigentlich ein Beharren ist, begründet sich letztlich aus der Weigerung, womöglich auch einem Unvermögen, einen letzten Strohhalm loszulassen. Als wolle man sich noch an irgend etwas festhalten, während das Karussell auf Touren kommt und schon beginnt zu ächzen. Eine Zerreissprobe mit sicherem Ausgang.
III
Die Werkgruppe „Ephemere“ bezieht sich sowohl thematisch als auch formal auf die Entdeckung (»Sichtung«) der Marktkarren der Turiner Markthalle. Es ist hier vor allem das „Unzeitige“ das heraussticht. Einerseits anachronistische mobile Vertreter des 18. und 19. Jahrhunderts, historisch technisch gesehen – was nicht heißt, dass die Herstellung der Wa- gen auch jüngeren Datums ist – und andererseits, aktueller integral funktionaler Bestandteil der Kybernetik des Marktes.
„Das Glatte ist die Signatur der Gegenwart. Es verbindet Skulpturen von Jeff Koons, i-Phone und Brazilian Waxing miteinander. Warum finden wir heute das Glatte schön? Über die ästhetische Wirkung hinaus spiegelt es einen allgemeinen gesellschaftlichen Imperativ wider. Es verkörpert nämlich die heutige Positivgesellschaft. Das Glatte verletzt nicht. Von ihm geht auch kein Widerstand aus.“ Das Glatte aus „Die Errettung des Schönen“ (Byung-Chul Han)
Der Begriff „Ephemere“ ist emblematisch zu verstehen. Als Signum unserer Zeit bündelt sich in ihm das für die Kultur der Gegenwart charakteristische Momentum des Vorübergehenden – zum Glatten passt das Gleiten. In den exzeptionellen Dingen unserer Zeit, konkretisieren sich, in nie da gewesener Weise – ohne Vorbild – (in diesem Sinne geschichtsvergessen) Wissen, Technizität und die Globalisierung der Kultur. Diesen Dingen eigen ist unter anderem eine physische Erscheinung von geradezu transzendierender Qualität, die sich mit tradierten Erfahrungen in Bezug auf Beschaffenheit, Herstellung und Herkunft kaum mehr erfassen lassen. In ihnen wird etwas Überzeitliches präsent, denn ihre Attraktivität resultiert aus einer Spannung eines an sich paradoxen Verhältnisses aus Distanz, von der Unkenntnis und Unerfahrenheit gegenüber dem Objekt herrührend, und gleichzeitiger Lust auf die
als unwiderstehlich erfahrene Perfektion des Gegenstandes. Selbst bei der Berührung wird die Distanz nicht überbrückt, im Gegenteil, der Gegenstand entgleitet, verharrt gewissermaßen im Unzeitlichen, in einem Zustand, der dem Idealen näher ist als dem Realen: man kann ihn zwar berühren aber nicht erfassen und noch bevor er sich in einem Gebrauchskontext etablieren, verfestigen kann, entzieht er sich der Eignung, Erprobung bzw. der Akkulturation durch den Ersatz des Neuen. Im Erscheinen formuliert sich bereits die Götterdämmerung des Gegenstandes, er kommt um zu gehen,
in ihm formuliert sich bereits das Neue, das Versprechen eines noch Attraktiveren.
Wir sind nicht sicher in unserer Zeit, zwar wähnen wir uns bereits in einer Distanz zur Moderne, in einer zeitlich geschichtlichen Opposition, die die Moderne als historisch und überwunden versteht.
Die Erfahrung der Beschleunigung (Überfülle der Ereignisse), der Differenzierung (Komplexitätszuwachs und -erfahrung) / (Überfülle des Raumes), der Shift der Perspektive von der Gesellschaft hin zum Subjekt (Individualisierung der Referenzen) wird einerseits selbstverständlich gelebt, andererseits aber nicht selbstbewusst und, vor allem, selbstsicher erlebt. Die Symptome sind Unsicherheit, die sich physisch als Schwindel manifestiert, das Gefühl des Verlustes an Verortung und schließlich, das Empfinden eines Unbehagens, resultierend aus der Erfahrung einer als diffus erlebten Identität.
Angesichts der Entgrenzung, des Verlustes an Fokusierung kommt die Katastrophe, vielmehr die Bedrohung, gerade recht. Sie wird gefürchtet, wie herbeigesehnt, sie bietet Orientierung über alles andere hinweg:
Angesichts des Klimawandels und der Pandemien machen sich die Katastrophenszenarien der Zeit wie Petitessen aus. Die Katastrophe egalisiert, sie ist basisdemokratisch: vor ihr sind tatsächlich alle gleich.
„Einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag“ so beschreibt Walter Benjamin den Begriff der Aura in seinem Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“. Es ist die Aura, die die Werke zu historischen Zeugen macht und ihnen Autorität verleiht. Mit der Reproduzierbarkeit hebt sich sowohl die Einmaligkeit auf, als auch deren Ferne, ein Kunstwerk wird zu jeder Zeit an jedem Ort darstellbar und besitzbar. Damit verliert es seine historische Zeugenschaft und letztlich seine Autorität.
Die Aura des Kunstwerks zerfällt zugunsten des Anliegens der Massen, sich mit der Aufnahme der Reproduktion die Dinge näherzubringen. Benjamin bedauert den Umstand des Verlustes nicht ausdrücklich, stellt doch die allgemeine Zugänglichkeit und Verfügbarkeit ein Gewinn dar.
Nach nunmehr nur zwei Generationen läßt sich aber feststellen, dass mit dem Verlust der Aura (auch wenn der Begriff nach wie vor hohe spekulative Spielräume läßt), des konkreten Ortes, wie des zeitlichen Rahmens eines Ereignisses oder eines Objekts, ein ebensolcher Verlust in der Rezeptions- und damit Identitätserfahrung zu verzeichnen ist. Die exklusive Erfahrung der „Ferne“ ist einer permanenten der „Nähe“ gewichen, die sich aber konsequent als Distanz konstituiert und entsprechend als nicht erreichbar erlebt wird.
Das Auratische des modernen Gegenstandes ist demzufolge die latente Erscheinung einer Nähe, so fern sie auch sein mag. Der Rezipient erfährt sich in dieser Nähe als Aussenstehen- der, als Zuschauer in einer Welt in der er zwar konkret vorhanden aber nicht verankert ist, als in einem Ozean des Lebens Treibender.
Einer der Grundannahmen der Arbeit ist die Erkenntnis, dass wir es versäumt haben, ein allgemeines, kritisches Bewusstsein gegenüber unserer Kultur zu entwickeln, statt dessen verharren wir in der Drift, in einer Indifferenz und damit einer Latenz gegenüber dem Leben. Dieses allerdings fordert ein Ankommen, wollen wir zu uns kommen:
es ist an der Zeit aufzuwachen.