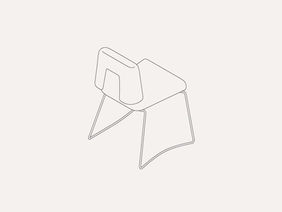Der Aesthet
Wenn ich sitze, will ich nicht
sitzen, wie mein Sitz-Fleisch möchte,
sondern wie mein Sitz-Geist sich,
säße er, den Stuhl sich flöchte.
Der jedoch bedarf nicht viel,
schätzt am Stuhl allein den Stil,
überlässt den Zweck des Möbels
ohne Grimm der Gier des Pöbels.
- Christian Morgenstern
Für den einen Gelegenheit, für den Gestalter Angelegenheit, und zwar eine delikate. Einerseits scheint es sich beim Gestühl allgemein um recht übersichtliche und einfach strukturierte Dinge zu handeln, andererseits, und eben drum, entpuppt sich hier das Einfache schon deshalb als das Schwierige als es jede Unaufmerksamkeit, jeden Patzer, das nicht zu Ende Entworfene, offensichtlich macht. Am Schlimmsten jedoch ist, selbst und gerade, wenn der Gegenstand aufs Vortrefflichste gelungen, er aber doch aus der Zeit gefallen ist und keinen Beitrag mehr leistet zum Lauf der Dinge. Hinter einem Stuhl läßt es sich schwer verstecken.
100 Stühle ist ein Kompendium von Entwürfen der letzten 30 Jahre. Begleitet werden sie von gedanklichen Skizzen, Aphorismen, die von den Begriffen und Begleitumständen des sich Setzens und des Sitzens handeln.
Hinsetzen um anzukommen.
Katzen sind nur ein Bruchteil ihres Lebens wach, den Rest liegen sie auf der faulen Haut. Man könnte sagen sie sind Entspannungswesen, was man vom Menschen nicht behaupten kann. Unsere Vorfahren waren ständig in Bewegung, täglich, bis zu 70 Kilometer, immer der ebenso rastlosen Nahrungsquelle, den Herden hinterher. Wer stehenblieb dem knurrte der Magen, diese Erkenntnis war so simpel wie existentiell und hat sich tief in das Bewußtsein unserer Vorfahren eingeschrieben, so tief, dass selbst wir Heutigen an einer geradezu pathologischen Unentspanntheit leiden, wie an den großen Muskeln unserer Beine, auch wenn es nichts mehr gibt, dem Nachzulaufen es lohnen würde. Aber wohin mit der Rastlosigkeit? Der physische Bewegungsdrang läuft in den Gymnasien ins Leere: Restless Feedsyndrom – ein stummer Reflex der Bewegung im Hamsterrad. Fortbewegung findet heute sinnvoll nur vermittelt statt, keiner läuft mehr irgendwo hin um etwas zu erreichen. Das Laufen eine atavistische Geste, verkommt zur Erbauungsgymnastik – wer weg will muss sich setzen. Paradoxerweise ist das Sitzen, das zur Ruhe kommen, die Voraussetzung der größeren Reichweite.
Was aber ist das Entwicklungsmotiv, das den Menschen in eine bewegungslose Ruhelosigkeit versetzt: zu gehen ohne aufzustehen...
Nicht nur anthropologisch betrachtet teilen wir mit allen Lebewesen ein ausgesprochen gut austariertes Bewegungs- und Ruheverhalten, äußerst zugespitzt auf eine Ökonomie der Energiegewinnung und des Energieverbrauchs. Nur wenige Lebewesen sind ihre Lage den auf einen bestimmten Lebensraum angepaßten Stoff- und Energieaustausch auf andere als die angestammten Habitate zu projizieren. Der Mensch kann das und zwar konnte er, als nackter Affe, seinen Lebensraum in dem Maße auf die gesamte Erdoberfläche ausdehnen als er Techniken der Adaption entwickelte.
Mit der Ausdehnung des Lebensraumes einhergehend ist eine Tendenz des Zur-Ruhe-Kommens, je weiter wir in die Welt hineingreifen desto sesshafter werden wir. Und um die Welt zu umspannen haben wir uns bereits recht früh, noch im Vorwärtsdrang, hingesetzt auf einem recht agilen Vierbeiner, der mit uns im Rücken die Weiten der Tundren durchmessend, half die Voraussetzungen unseres Handlungs- und Spielraums deutlich zu erweitern. Über Jahrtausende waren der menschliche und tierische Körper eng vereint, im Ergebnis entstand eine symbiotisch synchronisierte Bewegung – der Mensch ist auf dem Rücken des Tieres über sich hinausgewachsen und zwar, sitzend! Die ersten technischen Fortbewegungsvehikel bedeuteten allerdings in Folge die Götterdämmerung für diesen langen Gefährten mit dessen Hilfe die erste extentionelle Mobilisierung stattfand. Die territoriale Expansion geht einher mit exponentiellem Wachstum der Menscheit.
Vergleicht man die zurückgelegten Kilometer unserer Vorfahren mit den unsrigen trennen uns Welten, wir sind ungleich mobiler, erleben einen Zenit raumgreifender Rastlosigkeit. Betrachtet man die ehedem per Pedes bewältigten Strecken, stellt sich das Verhältnis nun allerdings umgekehrt dar: je weiter desto immobiler. Der Schluss liegt nahe, dass das Sitzen die Grundvoraussetzung einer wachsenden Beschleunigung darstellt.
Dabei folgt jedwede Form der Entwicklung von Fortbewegungsmitteln dem Paradigma der Substituierung von Bewegungserfahrung - allein die Beschleunigungsautomaten der Rummelplätze setzen noch auf die Attraktivität des aus der Ruhe gebrachten Körpers. Der erregende dromologische Schwindel ist letztlich das Ziel der Bewegung, die lustvolle Erfahrung eines orientierungslosen Selbst, welches sich, bezeichnenderweise ohne auch nur um einen Jota weiterzukommen, lediglich um (s)eine Achse dreht.
Wir sind nun Sesshaft(e) in einem transitorisch entgrenzten, in diesem Sinne unsicheren, instabilen Raum. Der Stimulus der durchmessenen Weiten erzeugt im Resultat eine Projektion, in diesem Zusammenhang werden die Öffnungen der Transportvehikel zunächst zu Schaufenstern , das zu Betrachtende, zum Aussen(Raum), zum Spektakel - vom Projekt zur Projektion. Aber auch hier findet ein Wandel statt. Wenn der Ausblick, das Fenster, zum Bildschirm wird, steht der Inhalt dessen was es zu Sehen gibt zur Disposition. Der Erfahrung der vermittelten Unmittelbarkeit vorbeieilender Welten als existentielle Voraussetzung der Aufmerksamkeit gegenüber dem Umgebungsraum mündet durch die Entkoppelung von Raum und Ereignis in der Beliebigkeit und damit Verfügbarkeit dessen was es zu sehen gibt.
Die Attraktoren, mithin die Attraktivität der Realwelt, erodiert und wird entweder gänzlich substituiert oder, weil disponibel, ersetzt durch räumlich, zeitlich der Situation enthobener Narrative die selbst wiederum in ihrer Dramaturgie gekennzeichnet sind durch eine sich exponentiell entwickelnde Beschleunigungssignatur.
Bewegung und Bewegungserfahrung sind nun zweierlei: der zur Ruhe gekommene, der sitzende Körper erzeugt eine Art diffus neutrale Situation, das Sitzen, eine Geste der Positionierung, beschreibt eine Figur der Erwartung, der Bereitschaft zur Aufnahme. Das zentrale Motiv, das des Sitzenden, in der sich der Mensch als Zentralgestirn eines eigenen Kosmos sieht, liegt in der Erwartung dessen was vor den Augen des Sitzenden, der ein Betrachtender, ein Zuschauer ist, passiert. Dieses verfängt um so eher, je mehr es sich bewegt. Der heutige Mensch ist ein Zügelloser, ein entschleunigter Beschleuniger, festgesetzt in einer Paralyse in der er sein Leben erfährt, je mehr er zur Ruhe kommt. Vom ausschreitenden, raumgreifenden Weltenwandler zum Zuschauer, zu einem Apologeten der guten Aussicht.
100_Stühle

100_Stühle
Der Aesthet
Wenn ich sitze, will ich nicht
sitzen, wie mein Sitz-Fleisch möchte,
sondern wie mein Sitz-Geist sich,
säße er, den Stuhl sich flöchte.
Der jedoch bedarf nicht viel,
schätzt am Stuhl allein den Stil,
überlässt den Zweck des Möbels
ohne Grimm der Gier des Pöbels.
- Christian Morgenstern
Für den einen Gelegenheit, für den Gestalter Angelegenheit, und zwar eine delikate. Einerseits scheint es sich beim Gestühl allgemein um recht übersichtliche und einfach strukturierte Dinge zu handeln, andererseits, und eben drum, entpuppt sich hier das Einfache schon deshalb als das Schwierige als es jede Unaufmerksamkeit, jeden Patzer, das nicht zu Ende Entworfene, offensichtlich macht. Am Schlimmsten jedoch ist, selbst und gerade, wenn der Gegenstand aufs Vortrefflichste gelungen, er aber doch aus der Zeit gefallen ist und keinen Beitrag mehr leistet zum Lauf der Dinge. Hinter einem Stuhl läßt es sich schwer verstecken.
100 Stühle ist ein Kompendium von Entwürfen der letzten 30 Jahre. Begleitet werden sie von gedanklichen Skizzen, Aphorismen, die von den Begriffen und Begleitumständen des sich Setzens und des Sitzens handeln.
Hinsetzen um anzukommen.
Katzen sind nur ein Bruchteil ihres Lebens wach, den Rest liegen sie auf der faulen Haut. Man könnte sagen sie sind Entspannungswesen, was man vom Menschen nicht behaupten kann. Unsere Vorfahren waren ständig in Bewegung, täglich, bis zu 70 Kilometer, immer der ebenso rastlosen Nahrungsquelle, den Herden hinterher. Wer stehenblieb dem knurrte der Magen, diese Erkenntnis war so simpel wie existentiell und hat sich tief in das Bewußtsein unserer Vorfahren eingeschrieben, so tief, dass selbst wir Heutigen an einer geradezu pathologischen Unentspanntheit leiden, wie an den großen Muskeln unserer Beine, auch wenn es nichts mehr gibt, dem Nachzulaufen es lohnen würde. Aber wohin mit der Rastlosigkeit? Der physische Bewegungsdrang läuft in den Gymnasien ins Leere: Restless Feedsyndrom – ein stummer Reflex der Bewegung im Hamsterrad. Fortbewegung findet heute sinnvoll nur vermittelt statt, keiner läuft mehr irgendwo hin um etwas zu erreichen. Das Laufen eine atavistische Geste, verkommt zur Erbauungsgymnastik – wer weg will muss sich setzen. Paradoxerweise ist das Sitzen, das zur Ruhe kommen, die Voraussetzung der größeren Reichweite.
Was aber ist das Entwicklungsmotiv, das den Menschen in eine bewegungslose Ruhelosigkeit versetzt: zu gehen ohne aufzustehen...
Nicht nur anthropologisch betrachtet teilen wir mit allen Lebewesen ein ausgesprochen gut austariertes Bewegungs- und Ruheverhalten, äußerst zugespitzt auf eine Ökonomie der Energiegewinnung und des Energieverbrauchs. Nur wenige Lebewesen sind ihre Lage den auf einen bestimmten Lebensraum angepaßten Stoff- und Energieaustausch auf andere als die angestammten Habitate zu projizieren. Der Mensch kann das und zwar konnte er, als nackter Affe, seinen Lebensraum in dem Maße auf die gesamte Erdoberfläche ausdehnen als er Techniken der Adaption entwickelte.
Mit der Ausdehnung des Lebensraumes einhergehend ist eine Tendenz des Zur-Ruhe-Kommens, je weiter wir in die Welt hineingreifen desto sesshafter werden wir. Und um die Welt zu umspannen haben wir uns bereits recht früh, noch im Vorwärtsdrang, hingesetzt auf einem recht agilen Vierbeiner, der mit uns im Rücken die Weiten der Tundren durchmessend, half die Voraussetzungen unseres Handlungs- und Spielraums deutlich zu erweitern. Über Jahrtausende waren der menschliche und tierische Körper eng vereint, im Ergebnis entstand eine symbiotisch synchronisierte Bewegung – der Mensch ist auf dem Rücken des Tieres über sich hinausgewachsen und zwar, sitzend! Die ersten technischen Fortbewegungsvehikel bedeuteten allerdings in Folge die Götterdämmerung für diesen langen Gefährten mit dessen Hilfe die erste extentionelle Mobilisierung stattfand. Die territoriale Expansion geht einher mit exponentiellem Wachstum der Menscheit.
Vergleicht man die zurückgelegten Kilometer unserer Vorfahren mit den unsrigen trennen uns Welten, wir sind ungleich mobiler, erleben einen Zenit raumgreifender Rastlosigkeit. Betrachtet man die ehedem per Pedes bewältigten Strecken, stellt sich das Verhältnis nun allerdings umgekehrt dar: je weiter desto immobiler. Der Schluss liegt nahe, dass das Sitzen die Grundvoraussetzung einer wachsenden Beschleunigung darstellt.
Dabei folgt jedwede Form der Entwicklung von Fortbewegungsmitteln dem Paradigma der Substituierung von Bewegungserfahrung - allein die Beschleunigungsautomaten der Rummelplätze setzen noch auf die Attraktivität des aus der Ruhe gebrachten Körpers. Der erregende dromologische Schwindel ist letztlich das Ziel der Bewegung, die lustvolle Erfahrung eines orientierungslosen Selbst, welches sich, bezeichnenderweise ohne auch nur um einen Jota weiterzukommen, lediglich um (s)eine Achse dreht.
Wir sind nun Sesshaft(e) in einem transitorisch entgrenzten, in diesem Sinne unsicheren, instabilen Raum. Der Stimulus der durchmessenen Weiten erzeugt im Resultat eine Projektion, in diesem Zusammenhang werden die Öffnungen der Transportvehikel zunächst zu Schaufenstern , das zu Betrachtende, zum Aussen(Raum), zum Spektakel - vom Projekt zur Projektion. Aber auch hier findet ein Wandel statt. Wenn der Ausblick, das Fenster, zum Bildschirm wird, steht der Inhalt dessen was es zu Sehen gibt zur Disposition. Der Erfahrung der vermittelten Unmittelbarkeit vorbeieilender Welten als existentielle Voraussetzung der Aufmerksamkeit gegenüber dem Umgebungsraum mündet durch die Entkoppelung von Raum und Ereignis in der Beliebigkeit und damit Verfügbarkeit dessen was es zu sehen gibt.
Die Attraktoren, mithin die Attraktivität der Realwelt, erodiert und wird entweder gänzlich substituiert oder, weil disponibel, ersetzt durch räumlich, zeitlich der Situation enthobener Narrative die selbst wiederum in ihrer Dramaturgie gekennzeichnet sind durch eine sich exponentiell entwickelnde Beschleunigungssignatur.
Bewegung und Bewegungserfahrung sind nun zweierlei: der zur Ruhe gekommene, der sitzende Körper erzeugt eine Art diffus neutrale Situation, das Sitzen, eine Geste der Positionierung, beschreibt eine Figur der Erwartung, der Bereitschaft zur Aufnahme. Das zentrale Motiv, das des Sitzenden, in der sich der Mensch als Zentralgestirn eines eigenen Kosmos sieht, liegt in der Erwartung dessen was vor den Augen des Sitzenden, der ein Betrachtender, ein Zuschauer ist, passiert. Dieses verfängt um so eher, je mehr es sich bewegt. Der heutige Mensch ist ein Zügelloser, ein entschleunigter Beschleuniger, festgesetzt in einer Paralyse in der er sein Leben erfährt, je mehr er zur Ruhe kommt. Vom ausschreitenden, raumgreifenden Weltenwandler zum Zuschauer, zu einem Apologeten der guten Aussicht.